Jahreszeitliche
Struktur beobachteter Temperatur- und
Niederschlagtrends in
Deutschland
Christian-D. Schönwiese
Johann Wolfgang Goethe-Universität
Frankfurt a. M.
Institut für Meteorologie und Geophysik
Frankfurt a. M., Deutschland
Abstract
In the
context of the discussion of global or regional climate change, in addition to
extreme events, long-term trends are of outstanding interest. However, because
of the pronounced variability of climate in relation to time and space, special
regional analyses are necessary. In consequence, such an analysis with focus on
Germany and the climate elements surface air temperature such as precipitation
is presented. In particular, the seasonal/monthly trend characteristics related
to selected time intervals between 1891 and 2000 are considered. One of the
most spectacular results is an intensifying warming and wetness in winter
whereas the summer warming is accompagnied by a trend change from decreasing to
increasing precipitation in recent decades.
Zusammenfassung
Im Rahmen der Diskussion des globalen bzw. regionalen Klimawandels sind, neben Extremereignissen, Langfristtrends von besonderem Interesse. Doch erfordert die ausgeprägte Klimavariabilität in Zeit und Raum spezielle regionale Detailuntersuchungen. Daher wird hier eine solche Analyse für Deutschland und die Klimaelemente bodennahe Lufttemperatur sowie Niederschlag vorgestellt, mit besonderem Blick auf die jahreszeitlichen/monatlichen Besonderheiten der Trends in ausgewählten Zeitintervallen zwischen 1891 und 2000. Am auffälligsten ist dabei die sich verstärkende winterliche Temperatur- und Niederschlagszunahme, während im Sommer, unter ebenfalls Erwärmung, eine Trendwende von abnehmendem zu in den letzten Dekaden zunehmendem Niederschlag eingetreten ist.
1.
Klimatologischer Hintergrund
Das
globale Klima ist offensichtlich zeitlich/räumlich variabel und sowohl die
beobachteten bzw. rekonstruierten Strukturen dieser Variabilität als auch deren
Ursachen sind Gegenstand intensiver wissenschaftlicher wie öffentlicher
Diskussionen, insbesondere was mögliche anthropogene Einflüsse im Rahmen der
Umweltproblematik betrifft (Houghton
et al., 2001; Hupfer, 1991, 1996; Lozán
et al., 1998, 2001; Schönwiese, 1995). Die
räumliche Variabilität bewirkt, dass das globale Klima regional sehr
differenziert in Erscheinung tritt, und zwar nicht nur was den gegenwärtigen
Klimazustand betrifft (wie er auch immer definiert sein mag), sondern auch
hinsichtlich der verschiedenen Komponenten der zeitlichen Variabilität wie
Trends, Varianz und Extremwertverhalten. Leider sind der Aussagekraft der
Klimamodellierung, gerade bei der Simulation relativ kleinräumiger regionaler
Strukturen, aber auch generell-quantitativ wegen der nicht vollständig
verstandenen Rückkopplungen im Klimasystem, deutliche Grenzen gesetzt, wobei
hier vorwiegend die globalen gekoppelten Zirkulationsmodelle (GCM) von
Atmosphäre und Ozean gemeint sind (Houghton
et al., 2001).
Deshalb,
und da die Problematik der Klimaänderungen, insbesondere der anthropogenen,
nicht nur auf ihnen selbst, sondern vor allem auf deren Auswirkungen beruht,
und da gerade bei diesen Auswirkungen die regionalen Besonderheiten von
ausschlaggebender Bedeutung sind, ist es wichtig, auch klimadiagnostische
Betrachtungen der Klimavariabilität auf der Grundlage der Beobachtungsdaten
durchzuführen. Dies gilt sowohl global in möglichst weitgehender regionaler
Differenzierung als auch für Detailanalysen hinsichtlich ausgewählter Regionen.
Es liegt nahe, unter anderem auch aus Gründen der Datenverfügbarkeit, dies für
Europa bzw. Deutschland zu tun. In Fortführung bzw. Ergänzung zu früheren
derartigen Arbeiten (Rapp und Schönwiese, 1996; Schönwiese und Rapp, 1997; Rapp, 2000; Schönwiese, 2002)
wird im folgenden eine neoklimatologische (d.h. auf direkt gewonnenen
Beobachtungsdaten beruhende) Trendanalyse der bodennahen Lufttemperatur und des
Niederschlags für Deutschland vorgestellt. Der Fokus liegt hier allerdings
weniger auf den selbst innerhalb Deutschlands erheblich ausgeprägten
(sub)regionalen Besonderheiten (vgl. dazu o.a. Literatur), sondern auf den
jahreszeitlichen Strukturen.
2.
Methodische Aspekte und Motivation
Zeitreihen
von Klimaelementen weisen im allgemeinen eine Überlagerung unterschiedlicher
Strukturen auf (Erhard
et al., 1992; Schönwiese, 2000), nämlich linearer oder
nicht-linearer Trend (falls nicht entdeckbar, Mittelwert), Jahresgang
(saisonale Komponente), weiteren mehr oder weniger zyklischen
Variationskomponenten, ggf. eine sog. glatte Komponente (in der üblichen
spektralen Varianzanalyse nicht mehr auflösbarer tieffrequenter
Variationsanteil, auch episodische oder polynomiale Komponente genannt) und
unregelmäßigen Variationen, die auch das Eintreten damit verbundener extremer
Werte beinhalten (konventionell als relativ kurzfristige und relativ starke
Abweichungen vom Mittelwert bzw. Trend definiert; alternative Definition siehe Grieser et al., 2000, 2002).
Obwohl
es sinnvoll ist, beispielsweise das Extremwertverhalten vom Trendverhalten zu
trennen, da rein rechnerisch Trends auch allein auf zufällig in der Nähe des
Reihenanfangs bzw. -endes auftretende Extremwerte (möglicherweise sogar
Messfehler) zurückgehen können, sollen hier die „tatsächlichen“ Trends ohne
vorangehende Zeitreihenzerlegung betrachtet werden. Sie können somit
unterschiedliche strukturelle (nicht zu verwechseln mit den physikalischen)
Ursachen haben.
Trendanalyen
sollten darüber hinaus der Frage nachgehen, ob die gefundenen Trends linear
sind oder nicht. Bei einer entsprechenden Analyse von 41 europäischen
monatlichen Temperaturreihen, die Trends bis zur 5. Ordnung zuließ, stellten
sich unter 35 gefundenen signifikanten (Niveau 95 %) Trends 29 als linear und 6
als nicht-linear heraus, von letzteren die Mehrzahl positiv progressiv (Grieser et al., 2000).
Dies deckt sich qualitativ mit vielen anderen derartigen Untersuchungen und
lässt den Schluss zu, dass bei der Temperatur und nicht zu kurzen (d.h.
mindestens mehrere Jahrzehnte) bzw. nicht zu langen (d.h. nicht wesentlich über
100 Jahre hinausgehenden) Zeitintervallen ein lineares Trendverhalten weitaus
am häufigsten ist, was die Vergleichbarkeit der Trendwerte von Datenreihe zu
Datenreihe sehr erleichtert.
Weniger
gerechtfertigt ist dieser Schluss i.a. bei Niederschlagsreihen. So zeigte die
gleiche oben genannte Untersuchung bei 81 deutschen Niederschlagsreihen nur
etwa in der Hälfte der Fälle ein lineares, ansonsten überwiegend ein progressives
Trendverhalten. Da zudem Trends im allgemeinen zeitlich nicht stabil sind,
worauf noch näher einzugehen ist, lassen sich progressive Trends häufig auf
eine Verstärkung linearer Trends zurückführen, wenn sukzessiv unterschiedliche
Subzeitintervalle der Analyse zugrundegelegt werden. Dieses Vorgehen, wie es im
folgenden angewandt wird, beinhaltet den Vorteil, dass die
Vergleichsmöglichkeiten erhalten bleiben.
Die
Signifikanzprüfung von Trends zielt auf die Frage ab, wie deutlich sie sich von
der überlagerten zusätzlichen Variabilität unterscheiden, mit dem Problem, dass
auch statistisch nicht-signifikante Trends real und insbesondere wirkungsvoll
sein können. Trotzdem sollte auf Signifikanzprüfungen nicht verzichtet werden.
Am einfachsten ist dabei die Errechnung des Trend-/Rauschverhältnisses T/R,
wobei T der Trendwert und R meist durch die Standardabweichung der
Ausgangsdaten repräsentiert ist. Im Fall einer Normalverteilung gilt dann
näherungsweise für T/R > 1 ein Signifikanzniveau von Si = 70 %
(Irrtumswahrscheinlichkeit a = 0,3) und
für T/R > 2 ® Si = 95 % (a = 0.05). Etwas aufwendiger ist der
parameterfreie (keine Normalverteilung voraussetzende) Mann-Kendall-Trendtest (Schönwiese, 2000; Schönwiese und Rapp, 1997).
3. Ergebnisse
3.1
Temperaturtrends
Zunächst
soll ein Blick auf die Schätzwerte der bodennahen Lufttemperatur für das
Flächenmittel Deutschland, kurz die Deutschland-Temperatur, geworfen werden,
die in ihren Jahresanomalien (Referenzzeitintervall 1961-1990; der Anomaliewert
0 entspricht 8,3 °C) nach Rapp
(2000) in Abb. 1 dargestellt ist. Dabei stützen sich die
Werte ab 1761 auf lediglich 4, ab 1891 auf 31 und ab 1951 auf 75 Stationen ab.
Wesentlich mehr Stützstellen weisen die entsprechenden sog. Rasterdaten des
Deutschen Wetterdienstes auf (Müller-Westermeier,
2002), die jedoch erst ab 1901 vorliegen. Da ab dieser Zeit die Unterschiede
sehr gering sind, ist die in Abb. 1 dargestellte Reihe nur für 1997-2001 durch
diese Rasterdaten ergänzt.
Ausser den in Säulenform dargestellten Jahresanomalien sind in Abb. 1 noch eine 20-jährige Glättung (Gauß’scher Tiefpaßfilter, Methodik s. Schönwiese, 2000), die obere und untere Grenze der doppelten Standardabweichung (2s) sowie die linearen Trends 1761-1890 und 1891-2000 eingezeichnet. Diese Trends betragen - 0.2 °C (T/R << 1) bzw. + 0.9 °C (T/R = 1.3, entsprechend Si = 70%), wobei die säkulare Erwärmung noch etwas höher als die der entsprechenden global gemittelten Daten ist (dort + 0,7 °C, T/R = 2.7, entsprechend 99 % Signifikanz; vgl. Schönwiese, 2002; Houghton et al., 2001). Die wesentlich höhere Signifikanz des Globaltrends erklärt sich aus der Tatsache, dass räumliche Mittelung die Varianz (und somit das „Rauschen“) verringert, folglich T/R erhöht. Trotzdem ist der säkulare Temperaturanstieg sicherlich auch in Deutschland real, wie beispielsweise die markante Rückzugsreaktion der Alpengletscher zeigt (Häberli et al., 2001; Escher-Vetter, 2002).
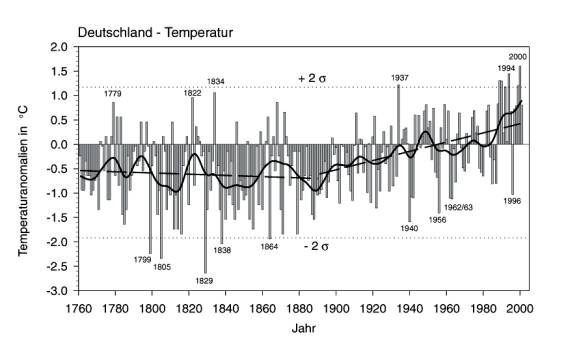
Abb 1: Jahresanomalien (Säulen) der bodennahen Lufttemperatur
1761-2001, Flächenmittel Deutschland, Daten nach Rapp (2000),
1997-2001 ergänzt nach Müller-Westermeier
(2002), mit 20-jähriger Glättung (dicke Kurve) und linearen Trends 1761-1890
bzw. 1891-2000 (gestrichelte Linien); ausserdem sind die obere und untere
Grenze der doppelten Standardabweichung (2 s) eingezeichnet
(gepunktete horizontale Linien) sowie
einige relativ warme bzw. kalte Jahre angegeben (mit dem bisherigen Wärmerekord
im Jahr 2000).
Es
soll nun aber der Frage nachgegangen werden, inwieweit die einzelnen
Jahreszeiten zur säkularen Erwärmung in Deutschland beigetragen haben und ob es
dabei Hinweise auf Trendabschwächungen oder -verstärkungen in den letzten
Jahrzehnten gibt. Zu diesem Zweck wurden für die Vergleichszeitintervalle 1891-1990
(säkular), 1961-1990 (letzte CLINO-Periode, CLINO = climate normals)
und 1981-2000 (nach Abb. 1 und auch global ungefähr Zeit der stärksten
Erwärmung) für alle Monate des Jahres die linearen Trends und
Trend-/Rauschverhältnisse (T/R) berechnet. Die Ergebnisse sind in Tab. 1 zusammengestellt,
einschließlich der Trends für die meteorologischen Jahreszeiten (Frühling =
März, April und Mai; Sommer = Juni, Juli und August; usw.) und das
Jahresmittel.
Dabei
zeigt sich zunächst, daß die Trends sowohl monatlich als auch zeitlich (d.h.
hinsichtlich der Referenzzeitintervalle) sehr unterschiedlich sind, auch wenn
die Erwärmungstrends deutlich überwiegen (1891-1990 gar kein Abkühlungstrend,
1961-1990 im April, Juni und September Abkühlungstrends, 1981-2000 im Juli und
November sowie, vernachlässigbar klein, im Herbst). Die Signifikanzen (Si)
sind, wie bei einer relativ kleinräumigen Untersuchung nicht anders zu
erwarten, sehr mager: Nur in wenigen Fällen wird das Niveau 70 % (T/R > 1)
überschritten, das Niveau 95 % (T/R > 2) gar nicht. Andererseits sind aber
deutliche Trendverstärkungen erkennbar, so bei den Jahresdaten (jeweils pro
Dekade von 0.07 °C, 1891-1990, über 0.23 °C, 1961-1990, auf 0.53 °C,
1981-2000), Frühlingsdaten (von 0.05 über 0.18 auf 0.6 °C pro Dekade) und
insbesondere Winterdaten (von 0.07 über 0.53 auf 1.08 °C pro Dekade), die
den stärksten Beitrag zur Erwärmung
liefern. Da im Winter auch die Varianz relativ hoch ist, bleiben jedoch auch in
diesen Fällen die Si-Werte unter 95 %.
Tabelle 1: Trends der bodennahen Lufttemperatur
(in °C), Flächenmittel Deutschland, für die angegebenen Zeitintervalle, Monate,
Jahreszeiten und das Jahresmittel (auf der Datengrundlage nach Rapp, 2000, ab
1997 ergänzt nach Müller-Westermeier,
2002; vgl. auch Schönwiese,
2002). Auf dem Niveau 70 % signifikante Trends sind durch Kursivschrift
gekennzeichnet.
|
Monat
bzw. Jahreszeit |
1891-1990 |
1961-1990 |
1981-2000 |
|
Januar |
0,78 °C |
1,53 °C |
1,85 °C |
|
Februar |
0,21 °C |
0,04 °C |
4,59
°C |
|
März |
0.52 °C |
1,54 °C |
0,91 °C |
|
April |
0,37 °C |
-
1,09 °C |
1,50
°C |
|
Mai |
0,49 °C |
1,18 °C |
1,15 °C |
|
Juni |
0,29 °C |
-
0,94 °C |
1,14
°C |
|
Juli |
0,42 °C |
0,57 °C |
- 0,37 °C |
|
August |
0,94 °C |
1,10 °C |
1,13 °C |
|
September |
0,99 °C |
- 0,34°C |
0,04
°C |
|
Oktober |
1,45
°C |
0,90 °C |
0,04 °C |
|
November |
1,18 °C |
0,20 °C |
-
0,34 °C |
|
Dezember |
0,88 °C |
3,27
°C |
0,34 °C |
|
Frühling |
0,46 °C |
0,54°C |
1,19 °C |
|
Sommer |
0,55 °C |
0,24 °C |
0,63 °C |
|
Herbst |
1,20
°C |
0,25 °C |
-
0,08 °C |
|
Winter |
0,68 °C |
1,60 °C |
2,15
°C |
|
Jahr
(insgesamt) |
0,72 °C |
0,68 °C |
1,06
°C |
Da
es zudem (sub)regionale (d.h. innerhalb Deutschlands) Strukturen der
Temperaturtrends gibt, die hier nicht betrachtet werden - erwähnt sei aber beispielsweise, dass
1966-1995 die stärkste winterliche Erwärmung mit über 2.2 °C im Nordosten von
Deutschland zu verzeichnen ist, die geringste mit unter 1 °C in Teilen
Westdeutschlands (Rapp,
2000; vgl. auch Rapp und Schönwiese, 1996) - ist festzuhalten, dass eine detaillierte
Trendanalyse der Beobachtungsdaten ein recht kompliziertes Bild ergibt, mit
ausgeprägten Strukturen, denen man mit der Pauschalaussage „Erwärmung“
keinesfalls gerecht wird.
3.2
Niederschlagtrends
Wie
im Fall der Temperatur soll auch die Niederschlagsbetrachtung mit einer
Zeitreihe des Flächenmittels Deutschland beginnen, vgl. Abb. 2, wo die
Monatssummen 1971-2002 (endend mit August 2002) dargestellt sind; Datenquelle
sind hier allein die Rasterdaten des Deutschen Wetterdienstes, siehe Müller-Westermeier
(2002), wo auch die Jahres- und Jahreszeitenwerte des insgesamt verfügbaren
Datenmaterials (ab 1901) in graphischer Form zu finden sind. Die ausgeprägte
Monat-zu-Monat-Variabilität ist deutlich zu erkennen, so dass sich das
Auffinden von systematischen/signifikanten Trends bei diesem Klimaelement
erwartungsgemäß noch wesentlich schwieriger gestaltet als bei der Temperatur.
Auf extreme Niederschlagsmonate soll im folgenden nicht eingegangen werden,
obwohl beispielsweise die relativ hohen Werte 12/93 (Dezember 1993) und 1/95
(Januar 1995) mit katastrophalen Winterhochwässern im Rhein-Einzugsgebiet,
8/2002 (letzte Säule der Graphik Abb. 2) mit einem noch katastrophaleren
Sommerhochwasser im Elbe-Einzugsgebiet verbunden waren. Da die entsprechenden
Starkniederschläge, insbesondere im Sommer, aber nicht flächendeckend in
Deutschland aufgetreten sind, fallen sie bei dieser Art der Analyse weniger auf
als bei regional/zeitlich höheraufgelösten Betrachtungen. (Der deutschlandweite
Rekordmonat 1971-2002 war 10/98.)

Abb. 2: Monatsanomalien (Säulen) des Niederschlages
Januar 1971 - August 2002, Flächenmittel Deutschland, Daten nach Deutscher
Wetterdienst (Müller-Westermeier,
2002) bzw. Weltzentrum für Niederschlagsklimatologie, mit Mittelwert
(ausgezogene Linie), sowie oberen und unteren Grenzen der einfachen (s) bzw. doppelten (2 s) Standardabweichung
(gestrichelte Linien); zudem sind einige Monate (in der Form Monat/Jahr) mit
relativ hohem Niederschlag angegeben (Säule ganz rechts: 8/2002).
Was
nun die Trends betrifft, so sind sie sowohl für das in Abb. 2 gezeigte
Zeitintervall, weiterhin für das CLINO-Intervall 1961-1990 (wie in Tab. 1,
ansonsten etwas abweichend) sowie das gesamte Zeitintervall (1901-2000)
berechnet worden, und zwar wiederum für alle Monate, Jahreszeiten und das Jahr
insgesamt. Die Ergebnisse sind in Tab.
2 zusammengefasst. Dabei zeigen sich wiederum ausgeprägte Strukturen, die sich
wie bei der Temperatur in unterschiedlichen Trendwerten für die einzelnen
Monate und Zeitintervalle äussern, und die statistischen Signifikanzen sind
eher noch geringer: Lediglich das 70 % - Niveau (T/R > 1) wird in einigen
Fällen überschritten, und zwar mit einer Ausnahme (August 1961-1990) nur in der
Referenzperiode 1971-2000 (Niederschlagsanstiege in den Monaten Februar, März,
September und dem Winter insgesamt). Allerdings sind die Beträge der Trends
nicht unerheblich, wobei ähnlich wie bei der Temperatur vor allem der Winter
hervortritt: Zunahme insgesamt (1901-2000) um rund 19%, Trendverstärkung in
jüngerer Zeit auf einen Wert von rund 35 % bezüglich 1971-2000. Dies schlägt
auch bei den Jahressummen durch, und zwar mit einer Zunahme insgesamt
(1901-2000) um rund 9 % und bezüglich 1971-2000 um rund 15 %.
Tabelle 2: Trends der Niederschlagssummen (in mm
und Prozent), Flächenmittel Deutschland, für die angegebenen Zeitintervalle,
Monate, Jahreszeiten und die Jahressumme (auf der Datengrundlage Deutscher
Wetterdienst, Müller-Westermeier
2002). Auf dem Niveau 70 % signifikante Werte sind durch Kursivschrift
gekennzeichnet.
|
Monat/Jahreszeit |
1901-2000 |
1961-1990 |
1971-2000 |
|
Januar |
+
6.2 mm (10.5 %) |
+
20.3 mm (33.3 %) |
4.2
mm (6.8 %) |
|
Februar |
+
8.7 mm (17.6 %) |
+
6.0 mm (12.1 %) |
31.0 mm (64.4 %) |
|
März |
+
16.0 mm (31.4 %) |
+
16.4 mm (29.0 %) |
28.2 mm (47.9 %) |
|
April |
-
1.2 mm (2.2 %) |
-
10.7 mm (18.4 %) |
-
0.2 mm (0.4 %) |
|
Mai |
+
7.5 mm (11.5 %) |
-
18.2 mm (25.5 %) |
-
5.0 mm (7.5 %) |
|
Juni |
+
13.8 mm (17.5 %) |
+
4.1 mm (4.8 %) |
-
11.8 mm (14.2 %) |
|
Juli |
-
8.3 mm (9.7 %) |
- 3.5 mm (4.5 %) |
+ 21.5 mm (26.7 %) |
|
August |
- 12.2 mm (15.3 %) |
- 22.3 mm (28.8 %) |
+ 0.6 mm (0.9 %) |
|
September |
+ 2.7 mm (4.2 %) |
+ 14.7 mm (24.1 %) |
+ 22.4 mm (34.9 %) |
|
Oktober |
+
2.5 mm (4.2 %) |
+
14.4 mm (25.8 %) |
+
17.2 mm (28.0 %) |
|
November |
+
11.6 mm (18.9 %) |
-
2.4 mm (0.4 %) |
-
12.6 mm (19.1 %) |
|
Dezember |
+
18.4 mm (28.5 %) |
+
14.3 mm (20.3 %) |
+
19.3 mm (26.5 %) |
|
Frühling |
+
22.4 mm (13.0 %) |
-
12.6 mm (6.8 %) |
+
23.0 mm (12.9 %) |
|
Sommer |
-
6.7 mm (2.7 %) |
-
21.7 mm (9.1 %) |
+
10.3 mm (4.4 %) |
|
Herbst |
+
16.7 mm (9.1 %) |
+
26.7 mm (14.5 %) |
+
26.9 mm (14.1 %) |
|
Winter |
+
33.1 mm (19.1 %) |
+
39.2 mm (21.9 %) |
+ 64.4 mm (35.2 %) |
|
Jahr
(insgesamt) |
+
65.7 mm (8.5 %) |
+
33.1 mm (4.2 %) |
+
114.8 mm (14.6 %) |
Im
Sommer ist insgesamt eine geringe Abnahme um rund 3 % eingetreten, die
innerhalb 1961-1990 mit rund 9 % noch etwas stärker ausfällt, jedoch 1971-2000
in eine Zunahme um rund 4 % übergegangen ist. Wie ein Blick auf die Monatswerte
verrät, haben dazu vor allem die Monate Juli und August beigetragen, während
der Juni jeweils das umgekehrte Trendverhalten zeigt. Der Frühling hat sich ab
1961 qualitativ ähnlich wie der Sommer verhalten (mit einem höheren Trendwert
1971-2000), der Herbst (mit generell geringeren Trendwerten, insbesondere
1971-2000) ähnlich dem Winter.
4.
Zusammenschau und Wertung
Temperatur
und Niederschlag sind nicht unabhängig voneinander und reagieren gemeinsam auf
die atmosphärische Zirkulation, die ihrerseits eine Folge der externen Antriebe
und internen Wechselwirkungen im Klimasystem ist (Hupfer, 1991, 1996; Hupfer und Kuttler, 1998; Schönwiese, 2003).
Allerdings sind die Temperatur-Niederschlag-Korrelationen jahreszeitlich
unterschiedlich: Im Winter sind, beispielsweise bei zonal orientierten
Großwetterlagen (hoher NAO-Index; NAO = Nordatlantik-Oszillation), Temperatur
und Niederschlag relativ hoch, bei Hochdruckwetterlagen tief; es herrscht daher
eine positive Korrelation vor. Im Sommer bringen dagegen Hochdruckwetterlagen
hohe Temperaturen und geringen Niederschlag bzw. Nordwestwetterlagen kühl-feuchte Witterung, so daß in dieser
Jahreszeit eher negative Korrelationen dominieren. Allerdings können im Sommer
hohe Temperaturen, wenn sie mit labiler Schichtung verknüpft sind, auch
Starkniederschläge hervorrufen. Generell komplizierter sind die Zusammenhänge
in den Übergangsjahreszeiten Frühling und Herbst.
Tabelle 3: Übersicht der Temperatur- und
Niederschlagtrends in den einzelnen Jahreszeiten in Deutschland; Werte über 1 °
C bzw. 10 % sind durch Fettdruck hervorgehoben (nach Rapp, 2000; Schönwiese, 2002).
Beim Winter- und Jahresniederschlag weichen die auf Rasterdaten beruhenden
Trendanalysen (vgl. Tab. 2, dort z.T. aber auch andere Zeitintervalle) etwas
von den nachstehend wiedergegebenen Werten ab.
|
Klimaelement, Zeitspanne |
Frühling |
Sommer |
Herbst |
Winter |
Jahr |
|
Temperatur, 1891 - 1990 |
+ 0,6 °C |
+ 0,7 °C |
+
1,2 °C |
+ 0,8 °C |
+ 0,8 °C |
|
1961 - 1990 |
+ 0,8 °C |
+ 0,4 °C |
0
|
+
1,7 °C |
+ 0,7 °C |
|
1981 - 2000 |
+
1,3 °C |
+ 0,7 °C |
-
0,1 °C |
+
2,3 °C |
+
1,1 °C |
|
Niederschlag, 1891 - 1990 |
+ 11 % |
0 % |
+ 16 % |
+ 19 % |
+ 9 % |
|
1961 - 1990 |
- 9 % |
- 8 % |
+ 10 % |
+ 20 % |
+ 3 % |
|
1971 - 2000 |
+ 13 % |
+ 4 % |
+ 14 % |
+ 34 % |
+ 16 % |
Vergleicht
man nun die Temperatur- und Niederschlagtrends in Deutschland für verschiedene Jahreszeiten
und Zeitintervalle (auf einen monatlichen Vergleich soll hier verzichtet
werden, obwohl die Tabellen 1 und 2 dies erlauben; siehe dazu Rapp, 2000),
wie das in Tab. 3 geschehen ist (dort einheitliche stationsbezogene Datenbasis
nach Rapp, 2000,
daher im Fall des Niederschlags leichte Abweichungen zu den in Tab. 2
angegebenen Rasterdaten-bezogenen Trends), so ist im Winter die
Temperaturzunahme erwartungsgemäß mit einer Niederschlagszunahme konsistent,
und dies trifft sogar auf die Trendverstärkung der letzten Jahrzehnte zu. Dies
erhöht sozusagen die physikalische Signifikanz der Ergebnisse, obwohl die
statistische nach wie vor bescheiden ausfällt.
Im
Sommer sind trotz sich ebenfalls (bei insgesamt geringeren Werten)
verstärkender Erwärmung die Niederschlagtrends unterschiedlich gewesen:
Langfristig ist kein, 1961-1990 ein gering abnehmender und 1971-2000 ein gering
zunehmender Trend festzustellen. Während die Abnahme mit der oben genannten
negativen Korrelation konsistent ist, könnte eine Zunahme von extremen
Niederschlagsereignissen diese Korrelation sozusagen umkehren. Auch wenn die
jüngsten Hochwasserereignisse (Oder im Sommer 1997, Elbe und Nebenflüsse sowie
weitere Regionen vorwiegend Osteuropas im Sommer 2002; vgl. u.a. Bissolli et al.,
2002) als Indiz dafür angesehen werden könnten, sind diese Entwicklungen noch
unklar, so dass gerade hinsichtlich extremer Witterungsereignisse noch großer
Forschungsbedarf besteht (zeitlich/regional verfeinerte Analysen).
Der
Herbst hat sich besonders eigenartig verhalten: Während er säkular den höchsten
Temperaturtrend zeigt, verbunden mit einem deutlichen Niederschlagsanstieg
(somit eine Korrelation ähnlich den Wintergegebenheiten), ist in den letzten
Jahrzehnten - bei anhaltendem Niederschlagsanstieg - kaum mehr ein Temperaturtrend zu
entdecken. Im Frühling gibt es gewisse Ähnlichkeiten mit den Sommer-Trends,
einschließlich der Trendumkehr beim Niederschlag in den letzten
Jahrzehnten.
Zurück
zu den Winter- und Sommerbetrachtungen: Hier kann eine Beziehung zu den Trends
der Großwetterlagen hergestellt werden, wie sie aus Tab. 4, bezogen auf die
Station Potsdam, nach Hupfer (cit. Hupfer
und
Schönwiese, 1998) ersichtlich ist. Danach haben im Vergleich
der CLINO-Perioden 1901-1930 bis 1961-1990 die winter-milden Großwetterlagen in
letzter Zeit und die sommer-warmen systematisch zugenommen, die sommer-kühlen
entsprechend abgenommen. Im Winter hat es erst eine Zunahme und dann
(1961-1990) eine leichte Abnahme der kalten Großwetterlagen gegeben. Ähnliches,
insbesondere bei den damit zusammenhängenden Temperatur- und
Niederschlagtrends, zeigt sich auch in Klimamodellsimulationen (GCM) zum
anthropogenen Treibhauseffekt (Houghton
et al., 2002), obwohl diese Simulationen eher großräumige
Relevanz haben und dort die Niederschlagssignale besonders unsicher sind. Dies
gilt auch für Versuche, den anthropogenen Treibhauseffekt und damit
konkurrierende weitere anthropogene sowie natürliche Steuerungsmechanismen (z.B.
Sonnenaktivität, Vulkanismus, El Niño, NAO) in den Bobachtungsdaten
nachzuweisen (Grieser
et al., 2000).
Tabelle 4: Häufigkeit der Großwetterlagen mit
unterschiedlichen Temperaturbedingungen in Europa, bezogen auf die Station
Potsdam (nach Hupfer, hier nach Hupfer und Schönwiese, 1998).
|
Periode |
Sommer-warm |
Sommer-kühl |
Winter-mild |
Winter-kalt |
|
1901
- 1930 |
31.6
% |
51.0
% |
39.3
% |
27.1
% |
|
1931
- 1960 |
40.4
% |
49.3
% |
35.8
% |
33.3
% |
|
1961
- 1990 |
46.7
% |
42.3
% |
43.1
% |
31.2
% |
Und
bei beiden Vorgehensweisen, Modellsimulationen und Beobachtungsdatenstatistik,
zeigt sich, einschließlich der Querverbindungen zur NAO, im Winter (Erwärmung,
Niederschlagszunahme, anscheinend auch Zunahme extremer Niederschläge) ein deutlicheres
und konsistenteres Bild als im Sommer (wo nach GCM-Simulationen in
Mitteleuropa, verbunden mit der Erwärmung, eher eine Niederschlagsabnahme
erwartet wird). Die weiter bestehenden Unsicherheiten sowie die Ursachenfrage
der Klimavariabilität erfordern, dass Modellrechnungen und Klimadiagnostik Hand
in Hand vorankommen, wobei es bei der Erfassung zeitlich und vor allem räumlich
differenzierter Klimaänderungsstrukturen deutliche Vorteile im Bereich der
Klimadiagnostik gibt.
Danksagung
Herrn Kollegen P.
Hupfer danke ich für viele wertvolle Kontakte und insbesondere für die gute
Kooperation bei unserem gemeinsamen Beitrag für die deutsche und englische
Ausgabe des von ihm zusammen mit J.L. Lozán und H. Graßl herausgegebenen Buchs
„Warnsignal Klima“. Hinsichtlich der Datenbeschaffung danke ich dem beim
Deutschen Wetterdienst angesiedelten Weltzentrum für Niederschlagsklimatologie,
insbesondere unserem dortigen gemeinsamen Mitarbeiter (im Rahmen eines
DEKLIM-Projektes) Dr. J. Grieser, meiner Mitarbeiterin Frau Dipl.-Met S. Trömel
für die Unterstützung bei der Berechnung der Niederschlagtrends.
Literatur
Bissolli, P., L. Göring und C. Lefebvre:
Extreme Wetter- und Witterungsereignisse im 20. Jahrhundert. Deutscher Wetterdienst
(Hrsg.), Klimastatusbericht 2001 (2002), 20-31.
Erhard, U., et al.:
Praktisches Lehrbuch Statistik. 4. Aufl., Verlag moderne industrie,
Landsberg/Lech 1992, 326 S.
Escher-Vetter, H.:
Zum Gletscherverhalten in den Alpen im zwanzigsten Jahrhundert. In Deutscher
Wetterdienst (Hrsg.): Klimastatusbericht 2001 (2002), 51-57.
Grieser, J., T. Staeger und C.-D. Schönwiese: Statistische
Analyse zur Früherkennung globaler und regionaler Klimaänderungen aufgrund des
anthropogenen Treibhauseffektes. Bericht Nr. 103, Inst. Meteorol. Geophys. Univ. Frankfurt a.M. 2000, 228 S.
Grieser,
J., S. Trömel and C.-D. Schönwiese: Statistical
time series decomposition into significant components and application to
European temperature. Theor. Appl. Climatol. 71 (2002), 171-183.
Häberli,
W., M. Hölzle and M. Maisch:
Glaciers as key indicator of global climate change. In Lozán, J.L., H. Graßl
and P. Hupfer (eds.): Climate of the 21th Century: Changes and Risks. Wiss.
Auswertungen + GEO, Hamburg 2001, 212-220.
Houghton,
J.T., et al. (eds.): Climate Change 2001. The Scientific Basis
(Contribution of WG1 to the Third Assessment Report of the Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC)). Univ. Press, Cambridge 2001, 881 pp.
Hupfer, P.
(Hrsg.): Das Klimasystem der Erde. Akademie Verlag, Berlin 1991, 464 S.
Hupfer, P.:
Unsere Umwelt: Das Klima. Globale und lokale Aspekte. B.G. Teubner Verlagsges.,
Stuttgart/Leipzig 1996, 335 S.
Hupfer, P., und W. Kuttler
(Hrsg., begründet von E. Heyer): Witterung und Klima. 10. Auflage, B.G.
Teubner, Stuttgart/Leipzig 1998, 413 S.
Hupfer, P., und C.-D. Schönwiese:
Zur beobachteten Klimaentwicklung im 19. und 20. Jahrhundert. In Lozán, J.L.,
H. Graßl und P. Hupfer (Hrsg.): Warnsignal Klima. Das Klima des 21.
Jahrhunderts. Wiss. Auswertungen + GEO, Hamburg 1998, 99-113.
Lozán, J.L., H. Graßl und P. Hupfer
(Hrsg.): Warnsignal Klima. Das Klima des 21. Jahrhunderts. Wiss. Auswertungen +
GEO, Hamburg 1998, 465 S.; aktualisierte englischsprachige Ausgabe: Climate of
the 21th Century: Changes and Risks. 2001, 449 pp.
Müller-Westermeier, G.:
Klimatrends in Deutschland. In Deutscher Wetterdienst (Hrsg.):
Klimastatusbericht 2001 (2002), 114-124.
Rapp, J.:
Konzeption, Problematik und Ergebnisse klimatologischer Trendanalysen für Europa
und Deutschland. Bericht Nr. 212, Deutscher Wetterdienst, Offenbach 2000, 143
S.
Rapp, J., und C.-D. Schönwiese:
Atlas der Niederschlags- und Temperaturtrends in Deutschland 1891-1990. Band 5,
Serie B, Frankfurter Geowiss. Arbeiten, Frankfurt a.M. 1996, 255 S.
Schönwiese, C.-D.:
Klimaänderungen. Fakten, Analysen, Prognosen. Springer (TB), Berlin 1995, 224
S.
Schönwiese, C.-D.:
Praktische Statistik für Meteorologen und Geowissenschaftler. 3. Aufl.,
Borntraeger, Stuttgart 2000, 298 S.
Schönwiese, C.-D.:
Beobachtete Klimatrends im Industriezeitalter. Ein Überblick
global/Europa/Deutschland. Bericht Nr. 106, Inst. Meteorol. Geophys. Univ. Frankfurt a.M. 2002, 93 S.
Schönwiese, C.-D.:
Klimatologie. 2. Aufl., Ulmer (UTB), Stuttgart 2003, ca.
440 S. (im Druck).
Schönwiese,
C.-D. and J. Rapp:
Climate Trend Atlas of Europe - Based on Observations 1891-1990. Kluwer
Ac. Publ., Dordrecht 1997, 228 pp.