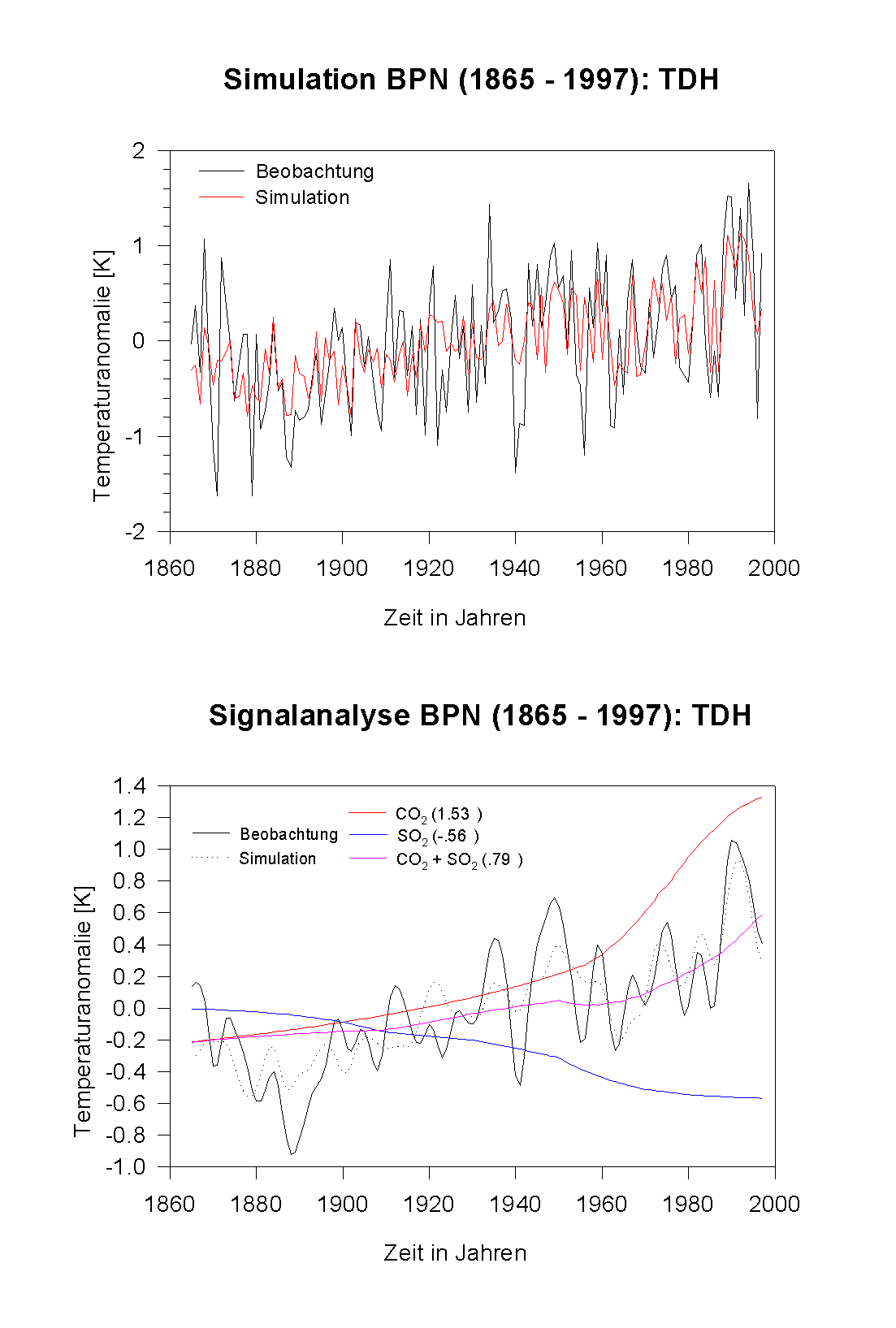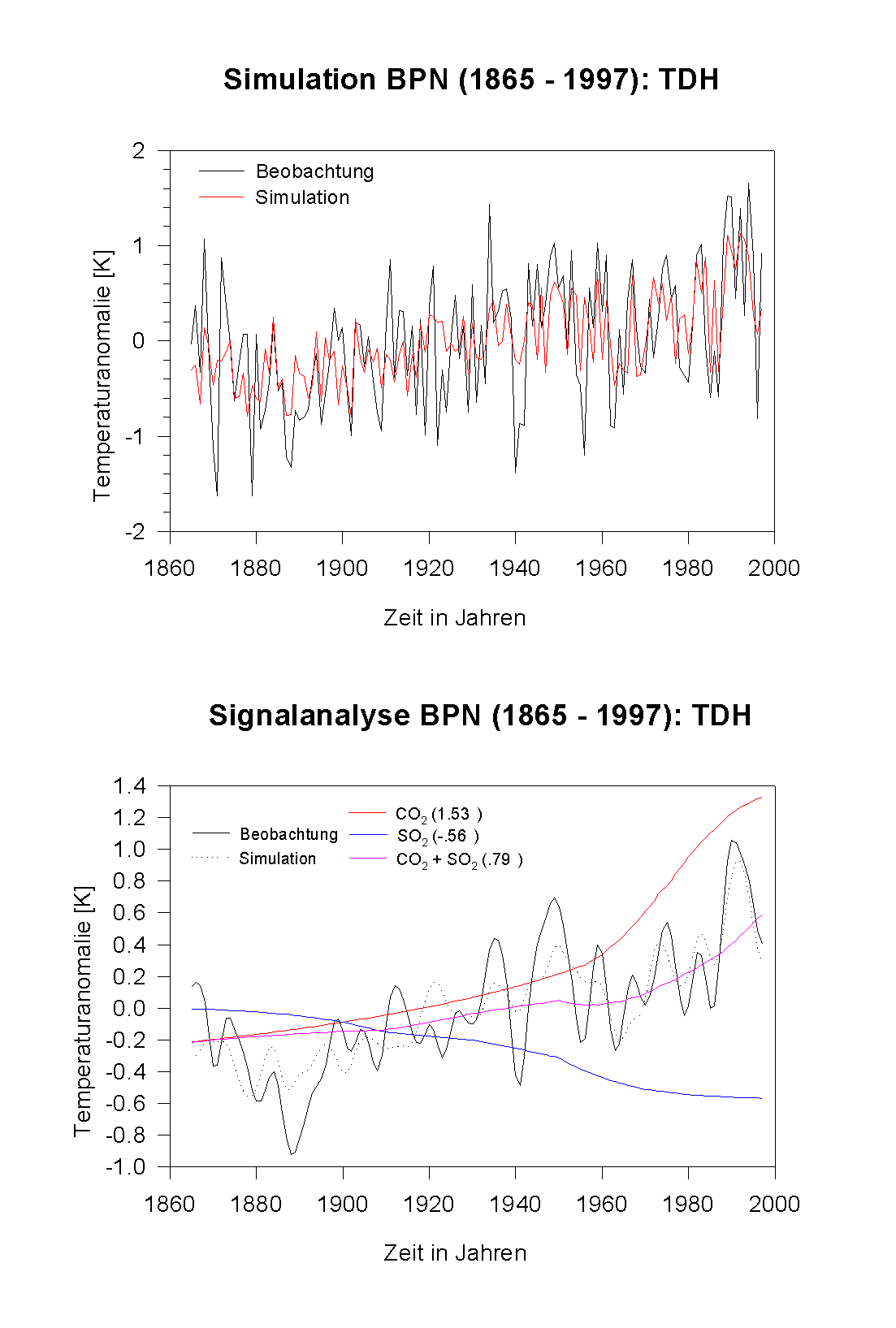
A.
Walter, C.-D. Schönwiese
Institut für Meteorologie und Geophysik
J.W. Goethe-Universität Frankfurt a.M.
Motivation und Zielsetzung
Im gleichen Heft berichtet J. Rapp über die beobachteten Variationen der bodennahen Lufttemperatur in Deutschland (Flächenmittel, im folgenden Deutschland-Temperatur genannt) und zeigt in seiner Abb. 1 die Jahresanomalien (Abweichungen vom Referenz-Zeitintervall 1961-1990) sowie die 20-jährig tiefpaßgefilterten (geglätteten) Daten für die Zeit ab 1761. Es ist nun von Interesse, auch die Ursachen für diese Variationen anzugeben oder zumindest Hypothesen darüber zu entwicklen.
Die Frage, ob und in welchem Ausmaß menschliche Eingriffe, wie sie sich im Konzentrationsanstieg der „Treibhausgase" sowie troposphärischen Sulfataerosole zeigen, das Klima beeinflussen, wird in Zusammenhang mit dem Phänomen weltweiter Klimaänderungen des Industriezeitalters nicht nur wissenschaftlich (IPCC, Houghton et al., 1996), sondern auch öffentlich intensiv diskutiert. Solche Einflüsse existieren sicherlich auch bei der Deutschland-Temperatur. Jedoch stehen dazu, und zwar global wie regional, viele natürliche Einflußfaktoren in Konkurrenz, insbesondere externe Einflüsse auf das Klimasystem durch den explosiven Vulkanismus und die Sonnenaktivität sowie interne Zirkulationsmechanismen der Atmosphäre bzw. des Ozeans wie ENSO (El Niño / Southern Oscillation) und NAO (Nordatlantikoszillation). Leider ist es derzeit unmöglich, mit Hilfe aufwendiger atmosphärisch-ozeanischer Zitkulationsmodelle alle diese Einflüsse simultan zu simulieren; hinzu kommt deren prinzipielle quantitative sowie regionale Unsicherheit.
Daher ist es sinnvoll, nach Alternativen zu suchen, welche die Tatsache der multiplen Klimasteuerung realisieren. Wie bei unseren globalen Untersuchungen (Walter et al., 1998; Schönwiese et al., 1998) verwenden wir nun auch hinsichtlich der Deutschland-Temperaturen ein solches alternatives und zwar statistisches Konzept, das zudem strikt auf den Beobachtungsdaten beruht und zumindest hypothetisch die Trennung der verschiedenen Klimasignale erlaubt (multiple Klima-Signalanalyse). Dabei versteht man unter Signalen die Variationsanteile beobachteter bzw. modellierter Klimaänderungen, die sich bestimmten Einzelursachen zuordnen lassen.
Neuronale Netze als Werkzeug der Klimaanalyse
In grober, aber wirkunsgvoller Nachahmung der menschlichen Vorgänge im Gehirn ist seitens der Physik bzw. Informatik das Konzept der neuronalen Netze entwickelt worden (Brause, 1991; Smith, 1993), das sich inzwischen einer breiten Anwendung in vielen Fachdisziplinen erfreut, in der Meteorologie/Klimatologie bisher jedoch bisher nur selten verwendet wird. Ein biologisches Beispiel mag zunächst das Prinzip der Wirkunsweise veranschaulichen: Auf der menschlichen Haut befinden sich sog. Wärme- und Kältepunkte, d.h. auf die Wahrnehmung von Wärme- bzw. Kältereizen spezialisierte Zellen. Diese sind mit Nervenzellen, den Neuronen, verbunden, die diese Reize an das Gehirn weiterleiten. Das Gehirn reagiert beim Überschreiten gewisser Reizschwellen dadurch, daß (über das vegetative Nervensystem) beislpielsweise Schwitzen ausgelöst wird, und das ist eine Reaktion auf zu hohe Wärmebelastung.
Übertragen auf die Informatik und unser Klimaproblem stellen die beobachteten zeitlichen Variationen der oben genannten anthropogenen wie natürlichen Klimafaktoren sozusagen die Reize dar, die der Eingabeschicht des neuronalen Netzes mitgeteilt werden. Die Reaktion, repräsentiert durch die Neuronen der Ausgabeschicht, ist die zeitlich variierende Temperaturvariation, und dazwischen, in der sog. verdeckten oder verarbeitenden Schicht, entsprechend dem Gehirn, erfolgt die Verknüpfung zwischen Einflüssen und Wirkung. Dabei wird beim sog. überwachten Lernen dem neuronalen Netz die tatsächlich eingetretene Reaktion, in diesem Fall die beobachteten Temperaturvariationen, mitgeteilt, was eine rückwärts-d.h. von der Ausgabe- in die verarbeitende Schicht gerichtete Fehlerkorrektur ermöglicht (Backpropagation). Es gibt zwar noch andere Architekturen von neuronalen Netzen; für die statistisch-klimatologische Signalanalyse ist aber dieser Typus am besten geeignet (Walter, 1996). Gegenüber der multiplen Korrelations- und Regressionsanlyse haben neuronale Netze den Vorteil, daß sie in einer Art Training optimale nicht-lineare Funktionen (i.a. sigmoider Art) zwischen Ursachen und Wirkungen aufsuchen (während multiple Regressionen entweder linear sind oder nicht-lineare Funktionen vorgegeben werden müssen) und sich die Einflußfaktoren auch gegenseitig beeinflussen dürfen.
Signalanalyse der Deutschland-Temperatur-Zeitreihe
In der oben geschilderten Art ist nun eine neuronale Netzwerk-Analyse der Deutschland-Temperatur-Zeitreihe 1865-1997 durchgeführt worden, wobei die zeitliche Einschränkung gegenüber des Beitrages von Rapp (dieses Heft) aus der begrenzten Verfügbarkeit der Zeitreihen der Einflußgrößen resultiert. Zudem beschränkt sich der anthropogene Einfluß weitgehend auf das Industriezeitalter. Schließlich ermöglicht das hier gewählte Zeitintervall einen Vergleich mit enstprechenden Analysen der Schätzwerte der globalen Mitteltemperatur.
Als anthropogene Einflußgrößen dienen anthropogen die jährlichen atmosphärischen Konzentrationswerte der äquivalenten Kohlendioxid-Konzentration sowie der Schwefeldioxid-Emission, die proportional der troposphärischen Sulfataerosolkonzentration sind. Zu allen Details, auch hinsichtlich der natürlichen Klimafaktoren, vergl. einerseits IPCC (1996) und andererseits Schönwiese et al., 1998 (auch Schönwiese, 1995). Die Parametrisierung der explosiven Vulkantätigkeit in Form einer Zeitreihe erfolgte nach Grieser (1999), die entsprechende Zeitreihe der von der Sonnenaktivität modulierten solaren Ausstrahlung stammt von Lean et al. (1995; während bei unseren Globalanalysen bisher schlicht die damit gut korrelierten Sonnenflecken-Relativzahlen verwendet worden sind). Die in die Globalanalysen eingehende SOI-Zeitreihe (Southern Oscillation Index; nach IPCC) ist bei der Analyse der Deutschland-Temperatur durch den Index der NAO (Nordatlantikoszillation; Hurrel, #) ersetzt.
Abb. 1 zeigt zunächst die Reproduktion 1865-1997 der beobachteten Jahresanomalien der Deutschland-Temperatur bei Verwendung aller betrachteten Einflußgrößen durch das neuronale Netz. Der multiple Korrelationskoeffizient beträgt dabei r = 0,62, was einer erklärten Varianz von (r2) 39% entspricht. Das ist deutlich weniger als bei der globalen Mitteltemperatur (83%), im Fall einer regionalen Zeitreihe aber realistischerweise nicht höher zu erwarten. Außerdem fällt in Abb. 1 schon optisch auf, daß das neuronale Netz die hochfrequente Varianz deutlich unterschätzt, d.h. die betreffenden Amplituden der Zeitreihe sind bei den Beobachtungen wesentlich größer als bei der Modellreproduktion. In Abb. 2 sind nun die zugehörigen 10-jährig tiefpaßgefilterten Daten, bei denen diese Varianzunterschätzung nicht so ausgeprägt ist, zusammen mit den anthropogenen Signalen gezeigt, und zwar aufgrund des Konzentrationsanstiegs der Treibhausgase TR (Signalstärke + 1,53 °C), der Sulfataerosole SU (- 0,56 °C) und der (nicht-linearen) Kombination aus beidem TR+SU (+ 0,79 °C). Das bedeutet, daß das neuronale Netz dem anthropogenen Einfluß insgesamt einen zwar zeitlich ungleichmäßigen, aber langfristigen Temperaturanstieg von rund 0,8 °C zuordnet, nur unwesentlich mehr als im Fall der globalen Mitteltemperatur (rund 0,6 °C). Jedoch ist das anthropogene Treibhaussignal allein, wie es sich in dieser Analyse der Deutschland-Temperatur abzeichnet, deutlich höher als bei der globalen Mitteltemperatur.
Bei den natürlichen Signalen, vgl. Abb. 3, ist das NAO-Signal mit Abstand führend (Signalstärke 1,09 °C), jedoch nicht in Form eines Langfristtrends, sondern stark fluktuierend. Nur am Rande sei hier erwähnt, daß auch Modellrechnungen zum Zusammenhang zwischen anthropogenem Treibhauseffekt und NAO vorliegen (Paeth et al., 1999). Der Vulkanismus zeigt sich bei unserer Analyse in episodischen Abkühlungen (Signalstärke bis - 0,24 °C) nach größeren explosiven Vulkanausbrüchen, ganz ähnlich wie bei der globalen Mitteltemperatur. Die Befunde hinsichtlich des Einflusses der Sonnenaktivität sind mit unseren Globalanalysen wegen unterschiedlicher Parametrisierungen nicht direkt vergleichbar. Der Datensatz nach Lean et al. (1995) spiegelt nämlich einen größeren Einfluß wider, als er bei diversen alternativen Schätzungen in Erscheinung getreten ist (Schönwiese et al., 1994; Schönwiese et al., 1998; Cubasch et al., 1997). Bei der Deutschland-Tenperatur setzt sich unter Verwendung dieses Datensatzes der solare Einfluß aus einer Trend- und einer fluktuativen Komponente zusammen (Signalstärke insgesamt 0,64 °C), wobei der Trendanteil (lineare Regression der Signalzeitreihe von Abb. 3) bei etwa 0,3 °C liegt. Somit enthält die Deutschland-Temperaturreihe aufgrund der hier vorgestellten Analyseergebnisse auch einen bemerkenswerten solaren Anteil, der allerdings deutlich unter dem anthropogenen Treibhaussignal liegt. Die unerklärte Restvarianz, die bei der globalen Mitteltemperatur Zufallseigenschaften aufweist (Walter et al., 1998), dürfte im Fall der Deutschland-Temperatur auf nicht erfaßte Zirkulationsvorgänge zurückzuführen sein, teilweise wohl auch stochastischer Art.
Vergleich mit Globalanalysen und Schlußfolgerung
Die bereits mehrfach genannten Signalanalyse-Vergleiche
zwischen der Deutschland- (TDH) und Globaltemperatur (TGL) sind in Tab.
1 systematisch zusammengefaßt; und zwar enthält diese Tabelle
zunächst die globalen, auf die untere Atmosphäre bezogenen Strahlungsantriebe
der einzelnen zur Diskussion stehenden Klimafaktoren während des Industriezeitalters
(seit ca. 1850) nach IPCC-Angaben (Houghton et al., 1996) und in den weiteren
Spalten den Vergleich aller untersuchten anthropogenen sowie natürlichen
Signale hinsichtlich der Global- (TGL) und Deutschland-Temperatur (TDH).
Tab. 1: Auflistung der wichtigsten großräumig
wirksamen anthropogenen und natürlichen Klimafaktoren, zugehörige
globale Strahlungsantriebe (untere Atmosphäre) in industrieller Zeit
nach IPCC-Angaben (seit ca. 1850; Houghton et al., 1996) und Vergleich
der entsprechenden, mit Hilfe eines neuronalen Netzes geschätzten
Signale in der bodennahen Lufttemperatur im globalen (TGL, 1866-1994) bzw.
Deutschland-Mittel (TDH, 1865-1997; vgl. dazu auch Rapp, dieses Heft).
Der multiple Korrelationskoeffizient (erklärte Varianz) beträgt
hinsichtlich aller betrachteten Einflußgrößen und bezüglich
der ungefilterten Jahnresdaten: TGL 0,91 (83%), TDH 0,62 (39%).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Beim Pinatubo-Ausbruch 1991: 2,4 W/m2, 1992: 3,2 W/m2, 1993: 0,9 W/m2 (McCormick et al. 1995)
Bereits an anderer Stelle (Schönwiese et al., 1997, 1998) ist darauf hingewiesen worden, daß sich die statistisch geschätzten anthropogenen Signale im Klimageschehen gut in das Bild einfügen, das die globalen atmosphärisch-ozeanischen Zirkulationsmodelle liefern (IPCC, Houghton et al., 1996). Das ist auch insofern bemerkenswert, als diese Methodik gestattet, simultan auch weitere Einflüsse, insbesondere natürlicher Art, mit einzubeziehen und alle Abschägtzungen strikt auf Beobachtungsdaten beruhen. Außerdem wird das Konzept der neuronalen Netze der Tatsache der nicht-linearen Klimasteuerung gerecht.
Es ist hier gezeigt worden, daß dies im Prinzip auch hinsichtlich der Deutschland-Temperatur funktioniert. Allerdings ist in diesem Fall die erklärte Gesamtvarianz relativ klein, wie generell das Verständnis der regional-jahreszeitlich differenzierten Klimavariationen noch alles andere als befriedigend gelöst ist, ganz gleich, um welche Modelle es sich dabei handelt. Mit dieser Zielsetzung gibt es sicherlich noch großen, ebenso multimethodischen wie interdisziplinären Forschungsbedarf.
Literatur
Brause, R., 1991: Neuronale Netze. Teubner, Stuttgart.
Cubasch, U., Voss, R., Hegerl, G.C., Waszkewitz,
J., Crowley, T.J., 1997: Simulation of the influence of solar radiation
variations on the global climate with an ocaen-atmosphere general circulation
model. Clim. Dynamics, 13, 757-767.
Grieser, J., Schönwiese, C.-D., 1999: Parameterization
of spatio-temporal patterns of aerosol-induced stratospheric optical depth
and ist climate radiative forcing. Atmósfera, in print.
Houghton, J.T., Meira Filho, L.G., Callander,
B.A., Harris, N., Kattenberg, A., Maskell, K., 1996: Climate Change 1995
(Second Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change,
IPCC). Univ. Press, Cambridge.
Hurrel, J.M., van Loon, H., 1997: Decadal variations
in climate associated with the North Atlantic Oscillation. Clim. Change,
36, 301-326.
Lean, J., Beer, J., Bradley, R., 1995: Reconstruction
of solar irradiance since 1610: implications for climate change. Geophys.
Res. Letters, 22, 3195-3198.
McCormick, M.P., Thomason, L.W., Trepte, C.R.,
1995: Atmospheric effects of the Mt Pinatubo eruption. Nature, 373, 399-404.
Paeth, H., Hense, A., Glowienka-Hense, R., Voss,
R., Cubasch, U., 1999: The North Atlantic Oscillation as an indicator for
greenhouse regional climate change. In preparation, preprint available
from authors, Meteorol. Inst. Univ. Bonn.
Rapp, J., 1999: Beitrag in diesem Heft.
Schönwiese, C.-D., 1995: Klimaänderungen.
Daten, Analysen, Prognosen. Springer, Berlin.
Schönwiese, C.-D., Denhard, M., Grieser,
J., Walter, A., 1997: Assessments of the global anthropogenic greenhouse
and sulfate signal using different types of simplified climate models.
Theor. Appl. Climatol., 57, 119-124.
Schönwiese, C.-D., Ullrich, R., Beck, F.,
Rapp, J., 1994: Solar signals in global climatic change. Clim. Change,
27, 259-281.
Schönwiese, C.-D., Walter, A., Rapp, J.,
Meyhöfer, S., Denhard, M., 1998: Statistische Analyse der Klimavariabilität
und anthropogenen Klimasignale in globaler und regionaler Betrachtung.
Bericht Nr. 102, Inst. Meteorol. Geophys. Univ. Frankfurt a.M.
Smith, M., 1993: Neural Networks for Statistical
Modeling. Van Nostrand Reinhold, New York.
Walter, A., 1996: Die Anwendungsmöglichkeiten
selbstorganisierender neuronaler Netze in der Klimatologie am Beispiel
globaler und hemisphärischer Temperaturzeitreihen. Diplomarbeit, Inst.
Neteorol. Geophys. Univ. Frankfurt a.M.
Walter, A., Denhard, M., Schönwiese, C.-D.,
1998: Simulation
of global and hemispheric temperature variations and signal detection studies
using neural networks. Meteorol. Z., N.F., 7, 171-180.
Abb. 1: Beobachtete Jahresanomalien 1865-1997 der mittleren Deutschland-Temperatur (vgl. auch Beitrag Rapp, dieses Heft) und Simulation mit Hilfe eines neuronalen Netzes (Backpropagation), das als Einflußfaktoren die anthropogenen Treibhausgase und Sulfatpartikel sowie die natürlichen Einflüsse durch Vulkanismus Sonnenaktivität und NAO (Nordatlantikoszillation) enthält. Der mutiple Korrelationskoeffizient beträgt 0,62 (erklärte Varianz 39%).
Abb. 2: Ähnlich Abb. 1, jedoch 10-jährig
geglättete Daten, zusätzlich Zeitreihen der anthropogenen Signale
TR (Treibhausgase), SU (Sukfatpartikel) und TR+SU (Kombination ais beidem).